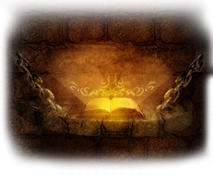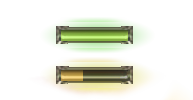Baxeda
Bluthexer auf Abwegen
Genre: Science Fantasy, Gay Romance
Status: Veröffentlicht, Bluthexer auf Abwegen bei Amazon
Inhalt:
Eine Fantasy-Kurzgeschichte mit männerliebenden Männern.
Die Bluthexer haben die Vollkommenheit für sich gepachtet – Fulcaire bildet die unrühmliche Ausnahme. Magisch gänzlich untalentiert schlägt sich der ewige Novize durch das Leben. Bei einem Ausflug in den sündigen Stadtstaat Obenza gerät er an den aufdringlichen Jungvampir Marlin, den Worte allein in seinem Tatendrang nicht aufzuhalten vermögen. In seiner Not ruft Fulcaire seinen Orden um Hilfe an. Ein Hexenmeister und ein Kampfhexer, die zufällig in der Nähe weilen, werden ihm als Verstärkung geschickt, um den liebestollen Blutsauger loszuwerden. Doch die beiden waren eigentlich aus einem ganz anderen Grund vor Ort und lassen sich in Gegenwart von so viel Unzucht, die ihrer Auslöschung harrt, nur allzu leicht von der Rettungsmission ablenken. Kann Fulcaires Unschuld gerettet werden?
Blaue Augen – Der Fall der Agenten der Autarkie
Genre: Fantasy, Homoerotik
Status: veröffentlicht,
Inhalt:
Gay Romance mit expliziten Szenen, eingebettet in eine mittelalterliche Fantasywelt.
Ihr Wort ist Gesetz und wenn sie das Schwert ziehen, fließt Blut: Die Agenten der Autarkie sind für die innere Ordnung des Großherzogtums Souvagne zuständig. Im Netz allgegenwärtiger Intrigen versucht der kauzige Agent Berzan Bovier vergebens, ein bürgerliches Leben mit Frau und Kindern zu führen. Als der hübsche wie unnütze Lehrling Eloy in sein Leben stolpert, ahnt er, woran es liegen könnte, dass ihm dies einfach nicht gelingen will.
Skorpionbrut

Ganz junges Projekt, von dem ich noch nicht weiß, ob ich es der Öffentlichkeit zugänglich machen werde oder nur für mich allein behalte.
Genre: Fantasy, Gay Romance
Status: 50% % des Erstentwurfes
Geplante Veröffentlichung: 2019
Eine düstere und grausame Geschichte. Hunger, der nicht zu stillen ist, eigensüchtige Menschenjagd, eingebetttet in ein Fantasyszenario.
Inhalt:
Sein Name ist Robere Moreau, seine Freunde sprechen ihn mit Robby an. Er selbst nennt sich Schwarzer Skorpion Sein Stachel bringt Schmerzen und seinesgleichen sind Beute. Doch ist der Panzer des Skorpions undurchdringlich? Auf den ersten Blick wirkt sein Kamerad Patrice von der Leibgarde wie das gefundene Fressen. Nahezu unfähig scheint er seinen Posten nur aufgrund von Bestechung erhalten zu haben. Doch stille Wasser sind tief und Robere ahnt nicht, dass er sich womöglich einem weiteren Jäger gegenübersteht. Die Geschichte beginnt jedoch nicht zu jener Zeit, sondern an ihrem wahren Anfang, viele Jahre zuvor, als das Unglück seinen Lauf nahm, das noch Jahrzehnte später das Leben von so vielen vergiftet und die Frage aufwirft, wie weit die Schuld des Einzelnen überhaupt reicht – und ab wann auch ein Jäger nur Spielball seines Schicksals ist.
Leseprobe:
Nestkälte
Souvagne, 168 nach der Asche. Waisenhaus Saint Aumery.
Skorpione gebären ihre Jungen in einem Erdloch. Wenn sie zur Welt kommen, gleichen sie ihren Eltern anatomisch so sehr, dass sie Miniaturen von diesen sein könnten. Vom Beginn ihres Lebens an sind sie mit Scheren, Stacheln und Panzer versehen. Nichts Niedliches ist an ihnen zu finden, sie betteln nicht nach Nahrung, sie weinen nicht und fordern keine Liebe. Stattdessen zehren von ihren Körperreserven, während sie geduldig auf die erste Häutung warten. Dann verlassen sie, noch winzig, ihre Mutter und leben allein. Mit jeder Häutung wird der Panzer härter, die Scheren kraftvoller und der Stich tödlicher. Vom Beginn seines Lebens an ist jeder Skorpion mit allem ausgestattet, was er zum Jagen braucht. Vor allem anderen aber – Geduld. Und die Fähigkeit, die extremsten Umweltbedingungen durch pure Zähigkeit zu überstehen.
Robere wurde im Jahr 167 nach der Asche in einer Welt geboren, die kaum freundlicher als das Erdloch eines Skorpiones war. Aufruhr herrschte damals im gesamten Land. Die Agenten der Autarkie, eigentlich eine Spezialeinheit zur Sicherung des Friedens, waren zur größten Bedrohung von Souvagne erwachsen. Es kam zu monatelangen Unruhen, als die Agenten plündernd ihr Unwesen trieben und zu einer Hungersnot. Um der Bedrohung Herr zu werden, wurde der Orden der Himmelsaugen ins Leben gerufen. Ein Staatsstreich durch die Agenten konnte gewaltsam verhindert werden und das war das Ende der Agenten der Autarkie und das Ende der Unruhen im Land. Die Himmelsaugen waren Helden und jedes magisch begabte Kind wollte später einmal Himmelsauge werden. Für Robere und viele andere gewöhnliche Kinder jedoch kam die einkehrende Ruhe zu spät. Ungeachtet der Witterung wurde er im Jahr 168, gerade ein Jahr alt, in einer Kiste vor der Tür das Waisenhauses Saint Amaury abgestellt, da seine Eltern ihn nicht mehr ernähren konnten.
Zumindest war das die Version, mit der man ihn und auch seinen besten Freund und Wahlbruder Boldiszàr abgespeist hatte, der mit ihm dieses Schicksal teilte.
Sie beide waren die einzigen Kinder des Heims, die namenlos nach Saint Aumery gekommen waren, ohne jeden noch so geringen Hinweis auf ihre Herkunft. Robere als Säugling, Boldiszàr als Vierjähriger. In anderen Waisenhäusern hatte es ähnliche Vorfälle gegeben, sagten die Erwachsenen, doch sie sprachen nicht gern davon.
Die Mönche, die das zum Tempel des Ainuwar gehörende Waisenhaus leiteten, hatten die beiden Kinder anhand einer Liste benannt und ihnen jene Namen zugewiesen, die als Nächstes an der Reihe waren. Eine Nummer hätte es nach Roberes Empfinden ebenso getan. Er hatte seinen Namen stets gehasst, der ihm ohne Liebe verliehen worden war. Schließlich hatte Boldiszàr ihm die naridische Form ›Robby‹ vorgeschlagen, die er von Marktbesuchen her kannte und damit konnte Robere besser leben.
Möglicherweise war das gemeinsame Schicksal, der blinde Fleck ihrer Herkunft, die Grundlage ihrer Verbundenheit. Robere und Boldiszàr nannten sich gegenseitig Brüder. Theoretisch war es möglich, dass sie tatsächlich Brüder waren und der Gedanke gefiel ihnen. Die Rolle des Beschützers aber nahm nicht der Große wahr, sondern der drei Jahre jüngere und einen Kopf kleinere Robere. Nicht, weil Boldiszàr unbedingt einen nötig gehabt hätte. Das ging von Robere aus. Wenn er die anderen Kinder malträtierte, um Ihren Gehorsam zu erzwingen, dann im besten Gewissen, seinem Bruder damit etwas Gutes zu tun. Andere Wege, seine Zuneigung auszudrücken, kannte Robere nicht und so wurde er im Laufe der Jahre ein zuverlässiger Schläger. Nach jedem Sieg knufften sie ihre Fäuste aneinander und Boldiszàr schenkte ihm eine selbstgedrehte Rauchstange. Qualmend saßen die beiden Jungs in ihrem Versteck hinter dem Holzschuppen und fühlten sich sehr erwachsen.
An seine Kindheit erinnerte Robere sich, abgesehen von der engen Freundschaft mit Boldiszàr, nur wenig. Es war, als ob sein Geist diese Zeit aus seiner Biografie streichen wollte, als sei er schon immer der Leibgardist gewesen, zweiter Mann von Unitè B, als sei er schon mit Rüstung und Bewaffnung zur Welt gekommen, wie die Skorpione es taten. Nein, mit dem Thema Kindheit wollte Robere möglichst wenig zu tun haben und er konnte Kinder auch nicht leiden.
Entsprechend gab es nur sehr wenige Ereignisse aus dieser Zeit, an die er sich im Detail erinnerte. Eines davon war jener Tag, als Boldiszàr krank wurde. Nicht nur ein wenig, mit Schnupfen und Heiserkeit, sondern todkrank.
Beißwerkzeuge
Neun Jahre war Robere alt und Boldi fast zwölf.
Wie es sich für Boldiszàr gehörte, der die Kinder des Waisenhauses anführte, war er aufgrund einer Verletzung krank geworden, die er sich im Kampf mit einem anderen Jungen zugezogen hatte. Bei solchen Auseinandersetzungen ging es für die Verhältnisse von Kindern sehr brutal zur Sache, denn es ging um nichts weniger als das Überleben in dem verarmten und überfüllten Waisenhaus, das sich hauptsächlich über Spenden finanzierte. Meist ging es dabei um Essen, aber insbesondere in der kalten Jahreszeit auch um Kleidung.
Antoine hieß der Rivale, der genau so alt und so stark wie Boldi war, aber keinen Robere hatte, der durch seine Brutalität die Kinder fügsam machte. Antoine war durchsetzungsstark, aber er kämpfte allein. Lange hatte er auf eine passende Gelegenheit warten müssen. Schließlich war der Zeitpunkt gekommen. Robere war gerade zur Strafarbeit in der Küche abgestellt und Boldiszàr stand allein hinter dem Holzschuppen, um heimlich zu rauchen. Mit seinen elf Jahren war er in dem Alter, das Waisenhaus bald verlassen zu müssen. Antoine schlich näher. Bevor ihre Wege sich für immer trennten, mussten alte Rechnungen beglichen werden.
Antoine hatte sich aus Holz ein Messer geschliffen. Das Besteck aus der Küche wurde akribisch kontrolliert und nach den Mahlzeiten von jedem einzeln eingesammelt, denn Eisenbesteck war teuer. Aber auch dieses selbst gefertigte Messer würde seinen Zweck erfüllen. Er kam von hinten herangeschlichen, schlug mit der Faust an Boldiszàrs Kopf vorbei und riss dann die Klinge zurück nach hinten. Boldi war vollkommen überrascht und konnte den Kopf nicht rechtzeitig wegreißen. Das Messer traf ihn in den Mund und Antoine fetzte es seitlich weg. Ein Bogen aus rotem Blut spritzte gegen den Holzschuppen. Das Messer hatte Boldiszàrs Wange über die komplette Breite durchtrennt, vom Mundwinkel bis zu den Backenzähnen. Boldi fuhr mit seinem aufgeschlitztem Gesicht herum und kämpfte um sein Leben. Es wurde eine heftige Prügelei, aber am Ende gelang es ihm, Antoine auch ohne Roberes Hilfe zu vertreiben. Stark blutend kehrte er ins Innere des Hauses zurück, doch aufrecht gehend und nicht weinend. Dies war nicht nur beachtlich für einen Jungen dieses Alters, sondern für die Mönche auch erschreckend. Das Kind hatte die innere Härte eines Soldaten. Robere jedoch war hin und weg. Der Anblick, wie Boldiszàr unbeeindruckt von der Wunde durch die Tür schritt, prägte sich für immer in seinem Gedächtnis ein. Tiefer Respekt erfüllte ihn. In seinen Augen war Boldiszàr genau so ein Skorpion wie er selbst, nur, dass sein Bruder nichts davon wusste. Kein Skorpion vergoss Tränen oder bat um Hilfe und so tat auch Boldi es nicht. Er wusch eigenhändig seine Wunde sauber und legte sich ins Bett, bis ein Mönch kam, um nach ihm zu sehen. Robere saß all die Zeit über bei ihm auf dem Fußende des Bettes, schweigend, wachend.
Nun war das Waisenhaus wegen der Unruhen in den Jahren 167 und 168 noch immer hoffnungslos überfüllt. Für die Kinder gab es nur die notdürftigste Versorgung. Ein Mönch, der in der Heilkunst bewandert war, erbarmte sich, die Wunde zu nähen. Das gestaltete sich als schwierig, denn wegen der vergleichsweise geringen Schärfe des Holzmessers war die Wange mehr zerfetzt worden als zerschnitten. Die vernähte Wunde sah kaum besser aus als der klaffende Spalt. Die Narbe entzündete sich und wollte nicht heilen. Kein Kräutersud, kein Tee und kein Gebet verschaffte Linderung.
Bald lag Boldiszàr mit Fieber im Bett und vermochte nicht mehr, zu den Mahlzeiten im Speiseraum zu erscheinen. Er konnte aufgrund der Wunde nicht sprechen und als Robere ihm aufhelfen wollte, schüttelte er schwach den Kopf. Das machte Robere Angst. Das war nicht Boldi, Boldi war ein Kämpfer! Er konnte doch nicht einfach für immer liegen bleiben! Doch Boldiszàr erhob sich nicht. Und langsam begannen die Kinder, sich Antoine zuzuwenden.
Robere grübelte. Er kam auf den Gedanken, sein eigenes Essen aus dem Speisesaal zum Bett seines Freundes zu tragen, damit dieser etwas zwischen die Zähne bekam. Wenn er von jeder Mahlzeit die Hälfte übrig ließ, würde es für sie beide genügen. Sie würden davon nicht satt werden und noch weiter abmagern, aber sie würden auch nicht verhungern. Zumindest nicht nach Roberes kindlicher Berechnung. Und dann würde Boldiszàr wieder aufstehen. Ja, so würde er das machen.
Gleich zum Abendbrot versuchte er, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Doch eine Hand hielt ihn fest, als er mit seinem halb leer gegessenen Teller aufstand und nicht zum Topf, sondern in Richtung der Tür ging.
Streng sah der Mönch ihn an. »Wo willst du hin? Gegessen wird im Speisesaal. Setz dich und iss auf oder schütte es zurück in den Topf, falls später noch jemand etwas davon essen möchte.«
Es kam nur sehr selten vor, dass die Kinder Essen zurückgaben. Es wurde so gut wie immer aufgegessen und nur ausgekochte und leergesaugte Knochenreste landeten im Müll. Robere blickte zu dem schwarz gewandeten Mönch auf.
»Wenn ich aufgegessen habe, kriege ich dann noch was zu Essen für Boldi?«
»Wer so krank ist, sollte nichts essen«, erklärte der Gottesdiener aus dem Schatten seiner Kapuze heraus. »Es kommt nur Dreck in seine Wunde und das Verdauen ist für einen kranken Körper anstrengend. Wenn Boldiszàr wieder gesund werden soll, muss er ein paar Tage fasten. Sobald er wieder bei Kräften ist, so Ainuwar will, wird er die Treppe hinabsteigen, sich zu uns setzen und dann bekommt er sein Essen.«
Zwei Tage ließ Robere sich von der Erklärung, dass Fasten gut sei, ruhig stellen. Boldiszàr wurde immer schwächer, anstatt dass es ihm besser ging. Er konnte bald kaum noch die Augen öffnen und schlief die meiste Zeit oder war vielleicht sogar ohnmächtig.
Robere schmuggelte schließlich einen Mund voll Hafergrütze hinauf auf das Schlafzimmer. Boldiszàr nahm den Schluck Nahrung zu sich, aber war danach immer noch hungrig. Das reichte nicht.
Düster brütend saß Robere auf seinem Bett. Sein Bruder sah schlimm aus, die zugenähte Wunde eiterte und seine Augen lagen tief in den Höhlen. Er wälzte den Kopf in Fieberträumen, das Haar klebte schweißnass an seinen Schläfen. In diesem Moment wurde Robere bewusst, dass man Boldiszàr aufgegeben hatte. Keiner der Mönche machte sich noch Hoffnung für seinen Bruder. Das Essen sollte den anderen Kindern zugutekommen und nicht dem Verlorenen. Die Logik war so nachvollziehbar wie kalt. Sie war nicht einmal grausam, diente sie doch dem Wohle aller und vielleicht war die Tat sogar gut gemeint. Doch das Wohl aller war etwas, dass Robere nicht interessierte. Ihn interessierte nur sein eigenes Wohl und das schloss Boldiszàr ein, der einen wesentlichen Beitrag dazu leistete. Er war zu sehr mit dem eigenen Überleben beschäftigt, um sich Gedanken um Leute zu machen, die ihm egal waren. Um ihn sorgte sich schließlich auch keiner – niemand außer sein Bruder. Und so wachte Robere seinerseits auch über Boldiszàr.
»Die Mönche sagen, dass du nur im Speisesaal essen darfst«, erklärte Robere ihm, ohne zu wissen, ob er ihn hören konnte. »Und so lange du nicht auf eigenen Füßen dorthin gehst, bekommst du nichts. Aber ich hole dir trotzdem was. Versprochen. Aber bis dahin musst du noch durchhalten.«
Robere machte sich auf den Weg zur Küche. Er schaute in den riesigen gusseisernen Topf, aus dem die Mönche die Hafergrütze ausgeschenkt hatten. Er war leer und sorgfältig abgewaschen, genau wie die Kelle und die Schüsseln der Kinder. Nirgends klebte ein Rest. Robere schaute in jeden Schrank und in jede Dose, doch nichts war hier oben zu finden, nicht einmal Zwiebeln oder getrocknete Kräuter. Es war wirklich ein besonders schlechtes Jahr. Er schlich in den Keller zur Speisekammer, von der er wusste, dass dort die Säcke mit Hafer aufbewahrt wurden, aus dem jeden Tag die Grütze gekocht wurde. Manchmal wurde sie mit Obst serviert, dann wieder mit Milch, Gemüse oder Fleisch. In den letzten Wochen hatte es den Haferschleim immer pur gegeben.
Robere zog am Riegel. Die Speisekammer war abgeschlossen. Sie hatte auch keine Fenster. Er probierte eine Weile mit einem Draht herum. Wie sehr er sich auch mühte, es gelang ihm nicht, das Schloss zu knacken. Am Ende versuchte er, die Tür einzutreten, doch sie federte seinen Fuß zurück und bekam nicht einmal einen Riss. Er rammte mit der Schulter dagegen und wurde erneut von dem zähen Holz zurückgeworfen. Hilflos stand Robere vor der verschlossenen Tür und starte auf den unnützen Riegel.
Wenn er Boldiszár retten wollte, musste er es anders versuchen, außerhalb des Waisenhauses. Hier gab es keine Hilfe. Die Mönche halfen einem Todgeweihten nicht und von den anderen Kindern war erst Recht kein Beistand zu erwarten. Entweder man überlebte, dann war es gut, oder man starb und machte Platz für andere, was vielleicht noch besser war in Anbetracht des Mangels. Niemanden kümmerte das Leben und Sterben eines ungewollten Kindes. Doch Robere würde Boldi nicht aufgeben.
Robere begab sich noch einmal in den Schlafraum, wo sein sterbender Freund lag, während die anderen Kinder in Haus und Garten tobten.
»Warte auf mich«, sagte Robere zu dem Schlafenden. »Kann sein, dass es ein bisschen dauert.«
Boldiszàr reagierte nicht. Robere pustete in seine Haare, doch er rührte sich nicht. Übelriechende Wundnässe lief seinen Kiefer herunter. Robere stopfte eine Socke darunter, damit das Kissen nicht noch schmutziger wurde. Ihm war nicht wohl dabei, ihn so wehrlos allein zu lassen. Er würde sich beeilen. Sicherheitshalber versteckte er alles von Boldiszàrs Habseligkeiten, was zum Klauen einlud, ehe er sich umkleidete.
Er zog seine geflickte Jacke über und setzte die Kapuze auf den Kopf, die wie ein Lappen auf seinen Haaren lag, dann stahl er sich von dem Gelände des Waisenhauses davon. Auszureißen war nicht schwer, das taten die Kinder oft. Manche waren nicht wiedergekommen. Die Mönche erzählten, dass sie von Kinderfängern geholt worden seien. Ob das stimmte, wusste Robere nicht. Vielleicht war der Hunger auch zu groß geworden oder die Tristesse der schwarz gewandeten und wortkargen Ainuwar-Mönche. Ainuwar war ein kalter, finsterer Gott, ein Gott des Verstandes. Gefühle hatten bei seiner Anhängerschaft wenig Platz. So verwunderte es nicht, dass es auch in Roberes Herz kalt und dunkel geworden war und wie berechnend er seine Mitmenschen wahrnahm. Dennoch war er nicht völlig gefühllos. Boldiszárs Zustand machte ihm Angst. Doch anstatt weinend an dessen Bett zu sitzen, tat er das einzig Vernünftige – er handelte. Wenn die Mönche ihn je etwas gelehrt hatten, was er für sein späteres Leben brauchen konnte, dann das.
Es nieselte. Nach langem Gehen durch den herbstlichen Regen fand Robere eine Apfelplantage. Sie war abgeerntet und das braune Laub lag in Haufen auf der nassen Wiese. Er suchte jeden Baum ab und fand noch zwei vergessene Äpfel. Die steckte er ein. Aber das würde nicht genügen, um Boldiszàr durchzubringen. Robere spazierte weiter zum Dorfzentrum, um zu schauen, ob er etwas aus den Gärten stehlen konnte, doch die Bewohner kannten die diebischen Waisenkinder und die Lästigkeit, die von ihnen ausging.
Ein Mann, in dessen Garten er einen riesengroßen Kürbis entdeckt hatte, jagte ihn brüllend mit erhobener Faust davon. So schnell er konnte, rannte Robere, bis die wütende Stimme hinter ihm nicht mehr zu hören war. Dann ging er langsamer weiter. Wo sollte er noch suchen?
Außerhalb des Dorfes setzte er sich auf eine Mauer, deren Stein dunkel war vom Nieselregen. Ihm fiel nichts mehr ein. Er, der keine Zeit hatte vergeuden wollen, um schnellstmöglich das Essen zurückbringen und seinen Bruder weiter vor Antoine bewachen zu können, saß hilflos im Herbst und sein Kopf war leer.
Robere weinte nicht. Er hatte sehr zeitig gelernt, es sich abzugewöhnen. Stattdessen war er wütend. Wütend auf die Mönche, die nichts taten, außer ihrem finsteren Gott zu dienen, wütend auf den Mann im Dorf, der nicht aussah, als ob ihn der Verlust des Kürbisses in den Ruin gestürzt hätte, wütend auf die Arbeiter, welche die Apfelbäume so gründlich abgeerntet hatten und vor allem wütend auf sich selber, weil er dem einzigen Menschen, dem er etwas bedeutete, nicht helfen konnte.
Da sah er etwas, das seine Aufmerksamkeit erregte. Eine Katze, das Fell struppig vom Regen, durch den Herbstregen streunend wie Robere. Genau so schwarzhaarig, genau so suchend, genau so hungrig. Ein einsamer Jäger. Wenn zwei Jäger sich trafen, jagten sie entweder gemeinsam oder der eine fraß den anderen auf. Und in Robere erwachte in diesem Moment das Bewusstsein, dass er jagen musste.
Der Wilde & der Chevalier
Status: veröffentlicht, Der Wilde & der Chevalier bei Amazon
Inhalt:
Khawas Krieger nennen ihn Steppensturm. Sie kommen, sie plündern, sie verschwinden und wo sie auftauchen, hinterlassen sie verbrannte Erde. Doch diesmal haben ihre Gegner vorgesorgt. Die Rüstungen der Almanen sind so legendär wie die Mauern ihrer Burgen und man sagt, selbst ihre Seelen währen wie geschmiedeter Stahl. Für die Steppenkrieger endet dieser Kampf in einem Desaster. Als lebende Trophäe führt man ihren besiegten Anführer Khawa in die Hauptstadt, um ihn dort dem Großherzog vorzuführen.
Der kauzige und kaltschnäuzige Chevalier Jules de Mireault ist einer von seinen Bewachern. Er ahnt nicht, dass er mit seinem Verhalten genau in das Beuteschema des Gefangenen fällt, der keineswegs so gebrochen ist, wie er tut. Stattdessen ärgert er Jules, wo er nur kann. In der einsamen Fremde wünscht Khawa den Tag herbei, an dem der Chevalier seinen Eisenpanzer abwirft – und ihm zeigt, wer der Mann hinter der Rüstung ist. Als sich zwischen ihnen eine Romanze anbahnt, gerät Khawa ins Nachdenken. Will er wirklich noch fliehen und in die Steppe heimkehren – oder wählt er um einer aussichtslosen Liebe willen freiwillig ein Leben, für das er nie geboren war?
Als ob die Situation nicht schon schwierig genug wäre, taucht plötzlich ein Hyänenreiter auf, der fest entschlossen ist, Khawa zurück nach Hause zu holen – und dessen almanischen Liebhaber dafür zu beseitigen.
Für Leser, die Tiefgang wollen – Fantasy, die lebt. Dich erwarten Romantik und explizite Sexszenen, eingebettet in eine anspruchsvolle Geschichte – aufgrund der hohen Nachfrage erstmals in Romanlänge.
XXL-Leseprobe:
Der letzte Tag
Jahr 194 nach der Asche. Ende des Winters in der rakshanischen Steppe.
Der Raureif schmolz in der aufgehenden Sonne, die gelben Grashalme tropften. Inmitten des schweigenden Grasmeeres, das sich von Horizont zu Horizont erstreckte, erwachte das Zeltlager zum Leben. Hyänen streiften im Morgennebel um das Lager herum und gruben Pelztiere im Winterschlaf aus. Ihre Reiter lungerten grüppchenweise auf Klappstühlen aus Knochen und Leder herum, noch träge zu dieser Stunde, frühstückten und unterhielten sich.
Auch Khawa kroch auf allen vieren durch den Zelteingang in den Tag hinaus, trotz der kühlen Witterung nur mit einem Lendenschurz aus getupftem Hyänenfell bekleidet. Seinen Turban hielt er noch in der Hand, er brauchte mehr Platz, als in seinem Einmannzelt zur Verfügung stand, um ihn zu binden. Er hielt Ausschau, ob jemand sich erbarmt hatte, Mokka zu kochen. Einige Männer bereiteten ihre Ausrüstung für den Abend vor, doch die meisten beschäftigten sich um diese Tageszeit gemütlich. Der Ernst des Krieges hatte noch Zeit, früh am Morgen war von den berüchtigten Hyänenreitern selten etwas zu befürchten. Erst wenn die Nacht sich auf die Steppe senkte, zogen sie los, um sich von anderen zu holen, was sie zum Leben brauchten, so wie es ihre Ahnen bereits getan hatten.
Der Kopf dieses Plündertrupps war Khawa fo-Azenkwed, den man den Steppensturm nannte. Mit seinen weichen Gesichtszügen wirkte er keineswegs wie der berüchtigte Krieger, als den man ihn kannte. Seine Eltern hatten ihn Khawa genannt, Kaffee in der Sprache ihres Volkes, denn das Haar der meisten anderen Rakshaner war schwarz wie das Gefieder des Rabengeiers, doch seines war braun. Auch sein Körper hatte die warme Farbe von Mokka, versehen mit einem Schluck Hyänenmilch. Auf seinem breiten Kreuz ruhte ein Zopf aus verfilzten Haarsträhnen, während er die Seiten kurz geschoren trug. Sein Kopf verschwand nun unter dem schwarzen Turban, den er aus Faulheit im Ganzen auf- und absetzte. Das lose Ende wickelte er mit raumgreifenden Bewegungen um Hals und Gesicht.
Heute hatte Sherkal sich geopfert, für alle einen großen Topf Mokka aufzusetzen, so wie er es ziemlich oft tat, seit er sich dazu entschieden hatte, offen um Khawa zu werben. Sherkal war gerade alt genug, als dass man ihn mit einer großzügigen Auslegung des Begriffes als Mann bezeichnen konnte. Ein Bursche, der den viel zu großen Namen eines legendären Kriegers trug.
»Huhu, Khawa!« Er trug zwei schüsselgroße Kaffeetassen herbei, die verführerisch dampften, reichte ihm eine und setzte sich mit ihm auf zwei herumstehende Stühle nahe des Feuers. »Reitet ihr heute raus?«
Nicht ganz zufällig trug er die selbe Frisur wie Khawa, mit dem einzigen Unterschied, dass er seine Filzlocken als Palme aus dem Turban herausschauen ließ, damit Khawa auch wirklich sah, wie ähnlich sie beide sich waren. Im Gegensatz zu den meisten Rakshanern besaß Sherkal keine dunklen, sondern stechend grüne Augen, die aus dem schwarzen Turban heraus leuchteten. In einigen Jahren mochte er einen gutaussehenden Mann abgeben.
»Erstmal einen Mokka trinken«, erwiderte Khawa schläfrig. »Vorher kann ich nicht denken.« Er zog sich den Schleier vom Gesicht, klemmte ihn unters Kinn und setzte die Tasse an die Lippen. Mit der Wärme des Tranks spürte er die Lebenskraft in seinen Körper zurückkehren.
Sherkal befreite ebenfalls Mund und Nase, um seinen Kaffee zu genießen. Er hatte sich so gesetzt, dass ihre Beine sich berührten.
»Also ich für meinen Teil hätte Lust, mitzureiten«, erklärte er. Als das Objekt seines Interesses ihm nicht antwortete, weil es trank, ergänzte er: »Ich meine, ich bin doch jetzt wirklich alt genug, um die Krieger zu begleiten.«
»Alt genug, um als Schwertfutter für die Eisenmänner zu enden, ja«, erwiderte Khawa. »Ihr Kommandant ist gut. Zu gut für meinen Geschmack.«
»Ich kann auf mich aufpassen«, motzte das Bübchen beleidigt. »Ich halte mich hinten und bearbeite sie mit Pfeil und Bogen, während ihr euch um den Nahkampf kümmert. Arbeitsteilung!«
Khawa grunzte. »Rüstungsbrechende Bögen sind zu stark für dich. Du schießt dir beim Spannen bloß wieder in den Fuß.«
»Oh, Mann!«, jammerte Sherkal. »Wie lange soll ich denn noch warten! Du lässt mich seit drei Jahren zappeln und schindest es immer weiter raus!«
»Aus gutem Grund. Sei ehrlich zu dir: Miss dich in Übungskämpfen, höre dir selbst beim Reden zu, sieh dein Gesicht im Spiegel eines Sees an oder meinetwegen in dieser Kaffeetasse – du bist kein Krieger. Und aus dir kann man auch keinen machen. Dein Vertrauen in allen Ehren, aber auch ich kann aus dir nicht den Helden zaubern, dessen Namen du trägst.«
»Das war fies! Du hast schließlich auch irgendwann mal angefangen, jeder hat das. Niemand kommt als fertiger Krieger zur Welt. Nicht mal der Ur-Sherkal.«
»Ja, aber der hat sich nie in den Fuß geschossen.«
»Das war ein Versehen und außerdem ist das jetzt drei Jahre her. Drei Jahre! Gib mir doch wenigstens eine Chance. Lass es mich versuchen und wenn es schief geht, bin ich ganz ruhig und nerv dich nie wieder.«
»Deine Familie hat viele hervorragende Kämpfer hervorgebracht. Du gehörst nicht dazu und das ist in Ordnung, es kann nicht jeder ein Krieger sein. Unsere Truppe kümmert sich um die Versorgung des Hauptheeres und wir brauchen gute Leute, die uns den Rücken freihalten. Du kannst nicht kämpfen, aber du kannst dafür andere Dinge.«
»Und die wären?«, fragte Sherkal wenig überzeugt.
Khawa schwieg. Er hatte keine Ahnung und wollte nicht lügen. Eigentlich war Sherkal ein kompletter Taugenichts, der nicht mal zum Aufräumen gut war. Er gab sich zweifelsohne Mühe, war aber zu zerstreut, um irgendetwas vernünftig erledigen zu können, ohne dass jemand daneben stand und ihm Anweisungen gab. Ohne Leitung war er so hilflos wie ein kleiner Junge. Es war wenig verwunderlich, dass er sich ausgerechnet zum Anführer der Truppe hingezogen fühlte. Khawa versprach nicht nur Führung und Sicherheit, er war zudem ein umgänglicher Kerl, so lange nur der Kaffeepegel stimmte.
»Siehst du«, rief das Bürschlein triumphierend, als das Schweigen allzu lange währte. »Du weißt keine Antwort! Du bist mit deinen Argumenten am Ende, also musst du mich mitnehmen. Dir fällt kein einziger Grund ein, warum ich im Lager bleiben sollte, weil ich mies aufräume und die Zelte, die ich aufbaue, sind auch schief!«
Khawa stellte seine halbleere Kaffeetasse neben sich auf den Boden und drehte seinen Klappstuhl nun ganz in Sherkals Richtung.
»Hör zu, Kleiner«, sagte er freundlich. »Ich weiß, warum du mitkommen möchtest. Es ist kein Geheimnis, dass du mich magst und mich vermisst, wenn ich fort bin. Auch dass du manchmal ein kleiner Angeber bist, ist mir bekannt. Ich mag dich ebenfalls, und zwar genau so, wie du bist. Du musst dich nicht vor mir beweisen. Ich habe die Verantwortung für diese Truppe und somit auch für dich. Meine Entscheidung steht, du bleibst im Lager und machst dich hier so nützlich, wie du es vermagst. Akzeptiere das, hm?«
Er legte den Arm um Sherkal, um ihn zu trösten. Das Bürschlein schmiegte sich an seine Flanke und schmachtete sichtlich verliebt. Irgendwo war es ja schon putzig, wie er ihn anhimmelte. Sherkals Augen kniffen sich kurz zusammen, als hätte er Khawas Gedanken gelesen.
»Trink doch noch einen Schluck Kaffee«, forderte er spitz.
Khawa tat ihm den Gefallen und hob die Tasse an die Lippen. Er trank einen großen Schluck unter den wachsamen grünen Augen. Da erkannte er den Grund für die Aufforderung. Auf dem Grund der Tasse lag etwas. Etwas Weißes. Khawa ahnte Schlimmes.
»Los, trink schon aus.« Sherkal knuffte ihn.
Khawa fügte sich. Wenn er nicht gerade im Einsatz war, mochte er keinen Streit. Er sparte seine Energie und Durchsetzungskraft lieber für den Ernstfall und Sherkal nutzte diese Charakterschwäche schamlos aus. Der Pegel der Tasse sank. Zum Vorschein kam, wie erwartet, eine Knochenkette. Wenn Khawa sie jetzt in die Hand nahm, hatte er ein ernstes Problem. Einfach hinstellen konnte er die Tasse aber auch nicht, ohne dass er seinen kleinen Verehrer gewaltig vor den Kopf stieß. Hilflos starrte er auf das im Kaffee treibende Schmuckstück.
»Das hast du nicht erwartet«, posaunte Sherkal mächtig stolz.
Die herumlungernden Krieger kamen neugierig näher. Als sie die Kette in Khawas Tasse sahen, brachen sie in Gejohle aus.
»Hat er dich schön reingelegt«, meinte Skiran. »Du bist zu lieb, das habe ich dir schon immer gesagt. Du solltest den Jungen dafür übers Knie legen oder mich das erledigen lassen, wenn du es nicht übers Herz bringst.«
Sherkal rutschte unruhig auf dem Hintern hin und her, während die Krieger blödelten. »Und?« Sein Blick spiegelte äußerste Besorgnis wieder.
Khawa betrachtete sein viel zu junges Gesicht und dann den Inhalt der Tasse. Sie beide trennten zehn Jahre Altersunterschied, etliche Zeit an geistiger und körperlicher Reife. Hinzu kam der Unterschied im Rang. Wenn überhaupt, dann hätte Khawa es sein müssen, der dem Burschen eine Knochenkette anbot und nicht umgekehrt. Skiran hatte Recht. Was das Kerlchen hier verzapfte, war an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Sherkals Augen wurden immer größer und sein Mund ging immer weiter auf, je länger die Antwort auf sich warten ließ. Khawas Widerstand bröckelte. Er brachte es nicht über sich.
»Na schön«, brummte er resigniert. »Leg mir die Kette um.«
Sherkal strahlte über beide Ohren. Mit spitzen Fingern angelte er die nasse Kette heraus. Khawa nahm seinen Turban vom Kopf, so dass er sie ihm bequem umlegen konnte. Naturgemäß hatte sich in Sherkals Tasse ein Duplikat der Knochenkette verborgen. Der Bursche nahm ebenfalls seinen Turban ab und Khawa bekleidete ihn mit dem Gegenstück. Als es vollbracht war, küssten sie und waren verheiratet. So schnell konnte es gehen.
Sherkal zog Khawa an der Hand in dessen winziges Zelt, das eigentlich nur für eine Person reichte, zog die Stoffbahnen vor dem Eingang zu und fiel über Khawa her, der es mit einer Mischung aus Erregung und Amüsement hinnahm. Ihm wurde der Lendenschurz vom Leib gerissen, gierige schmale Hände erkundeten jeden Winkel seines Körpers, drückten seine Beine auseinander, wollten alles anfassen. Dann drehte Sherkal ihn auf alle viere und verschaffte seiner Erregung Zugang. Er bohrte und stocherte in ihm herum. Khawa musste sich Mühe geben, nicht das Gesicht zu verziehen. Das Kerlchen stellte sich an wie der erste Mensch, aber ging mit einem Selbstbewusstsein vor, als würde ihm die Welt zu Füßen liegen. Wahrscheinlich war es sein erstes Mal und er hatte er sich im Vorfeld von irgendwem beraten lassen, der ihm gesagt hatte, er dürfe nicht zu schüchtern vorgehen. Hemmungslos quiekte Sherkal seine Lust heraus, so dass das ganze Zeltlager Bescheid wusste.
Danach tauschten sie die Rollen. Nun war es an Khawa, seinem Mann zu zeigen, wie man es richtig machte. Er nahm sich Zeit, damit Sherkal lernte, wie schön es sein konnte, auch ohne dass man dem anderen etwas beweisen zu müssen. Khawa ging sanft, aber bestimmt vor. Unter seiner Führung verschmolzen ihre Körper endlich in Harmonie. Sherkal stöhnte, wand erregt sein Hinterteil und kam noch ein zweites Mal, ehe auch Khawa den Höhepunkt erreichte.
Nachdem ihre Ehe nun auch körperlich besiegelt war, kuschelten sie nebeneinandergequetscht, wobei Khawa zur Hälfte auf der Rückwand liegen musste. Das Zelt war während des Aktes halb in sich zusammengestürzt, was Sherkal in seinem Treiben nicht hatte aufhalten können. Die obere Lederplane hing durch, irgendeine Stange musste gebrochen sein. Das Bürschlein hatte wahrlich ganze Arbeit geleistet. Das Zelt war kaputt und Khawa konnte sich nicht mehr ohne Schmerzen bewegen. Jetzt lag Sherkal friedlich da, sah dabei noch jünger aus, als er ohnehin schon war und schnarchte leise mit offenem Mund.
Was für ein Morgen. Da trank man ein Mal den falschen Kaffee und schon war man verheiratet. Die Vorhänge des Eingangs standen nun ein Stück offen und ein Strahl aus Licht fiel in das kleine, völlig durcheinandergebrachte Zelt. Draußen taten die Krieger, als hätten sie nichts gehört, indem sie lautstark ein Reiterlied sangen, das noch immer nicht zu Ende war. Irgendwer hatte hier einen schrägen Humor.
Khawa zog die Vorhänge zu und streichelte seinen Mann. Noch weniger als zuvor war er bereit, Sherkal heute Nacht mitzunehmen, wenn der Kampf ihn rief. Bei jedem Einsatz hatte er größere Sorgen, sie waren einige Male in schwere Bedrängnis geraten. Die Sonne schien durch die Vorhänge, erbeutete Stoffe aus Almanien, doch das war lange her. Momentan war Nahrung das Ziel. Das Licht ließ den Stoff leuchten, die einzige Lichtquelle im sonst dunklen Lederzelt. Khawa betrachtete schläfrig das Licht. Er und Sherkal verbrachten den gesamten Tag miteinander im Bett. Als die Vorhänge sich rot färbten, zusammen mit dem Himmel, wurde es Zeit. Die Hyänen riefen und verlangten nach Feindesblut. Khawa spürte den Sturm in sich heraufziehen. Ihn hielt nichts länger im Bett.
Steppensturm
Grenzregion zwischen almanischem Hoheitsgebiet und Wildnis.
Die Rakshaner nutzten die Gunst eines Wolkenbruchs für ihren Raubzug. Es war stockfinster. Der Regen perlte in Bächen von ihrer Überkleidung aus gefettetem Leder, die schwarzen Turbane wogen schwer vom Wasser. Dass Fell der ponygroßen Riesenhyänen war bis auf die Haut durchnässt und stand struppig ab. Bei solch einem Wetter würde man die nahenden Plünderer weder sehen, noch würden die Wachhunde sie riechen. Khawa hatte bei der Planung der Taktik alle Register gezogen: Die Truppenzusammensetzung, die Topografie, die Tageszeit und sogar das Wetter wurden zu seinen Werkzeugen.
»Herhören«, befahl er. Der klatschende Regen sorgte dafür, dass er in normaler Lautstärke zu seinen Kriegern sprechen konnte, während sie sich um ihn drängten. »Vor uns im Tal liegt das Gehöft, das ich uns ausgesucht habe. Das Gebäude braucht uns nicht zu interessieren, wir konzentrieren uns auf die Tiere. Wir setzen auf Geschwindigkeit und vermeiden Konfrontation. Wir kommen, wir rauben, wir verschwinden.«
Er blickte in die Runde. Die Männer folgten seiner Erklärung aufmerksam aus dunklen Augen, das Einzige, was von ihren verschleierten Gesichtern zu erkennen war. Er sah keine Angst. Es war nicht die Frage, ob sie Erfolg haben würden, keiner zweifelte daran. Es ging nur um das Wie.
»Skiran hält in Rufweite Wache, auch wenn kaum Störungen zu erwarten sind. Eskir führt Trupp eins. Er wird das Gatter öffnen, sobald alle in Position sind. Trupp eins jagt von hinten die Herde heraus, Trupp zwei unter meinem Kommando empfängt die Rinder mit einem Korridor. Sobald sie hier ankommen, flankieren wir sie und treiben sie im Galopp nach Norden, während Eskirs Männer von hinten aufschließen. Am Azursee machen wir Halt, lassen Mensch und Tier verschnaufen, dann geht es heim nach Rakshanistan mit einem Festessen, das für mehrere Monate reicht! Noch Fragen? Nein? Dann auf eure Positionen!«
Die Truppe kam in Bewegung. Unter den Pfoten der Hyänen schmatzte die schlammige Wiese des Weidelands. Auf das Tragen von Rüstungen hatten die Rakshaner verzichtet, weil sie nicht die Absicht hatten zu kämpfen und Gewicht sparen wollten, doch trug jeder von ihnen standardmäßig einen leichten Knochensäbel und einen Reiterbogen aus Horn bei sich, ebenso einen Köcher mit Pfeilen. Die Männer klopften sich gegenseitig aufmunternd auf die Schultern und ritten in die angewiesene Richtung.
Aufmerksam behielt Khawa seine Krieger im Auge. Es war keine aufwändige Abschiedszeremonie erfolgt, da niemand mit Verletzen oder gar mit Verlusten rechnete. Die Moral war trotz des miesen Wetters hervorragend, die Männer hochmotiviert nach ihrer Serie von Erfolgen. Die Taktik ihres Anführers, wegen der man ihn Steppensturm nannte, ging auf. Die Plünderer bleiben nie länger als ein paar Stunden am selben Ort und nie kehrten sie in das selbe Gebiet zurück. Die deutlich besser ausgerüsteten almanischen Ritter, die man in diesem Landstrich Chevaliers nannte, bekamen sie seit Monaten nicht zu fassen und die gesamte nordwestliche Grenzregion Almaniens war inzwischen verarmt, während man Khawa in Rakshanistan als Helden feierte.
Mit einem Fersenklopfen trieb er seine Hyäne an und postierte sich an der Flanke des lebenden Korridors. Sein Tier war unruhig und keckerte, weil es sich auf die Hatz freute. Die Hyäne trug, wie es bei Rakshanern üblich war, kein Zaumzeug, sondern wurde nur dich die Beine und die Stimme ihres Reiters gelenkt. So blieb der massige Kopf frei und sie konnte in alle Richtungen beißen, wenn es erforderlich war. Die Krieger hatten sich in Position gebracht, der Korridor stand bereit. Trupp eins war wegen des Starkregens schon nicht mehr zu sehen, obwohl sie nicht weit entfernt waren. Jeden Moment würde Eskir das Gatter öffnen und die Hatz konnte beginnen.
Ein Schrei gellte und endete abrupt. Alle Köpfe fuhren herum. Hinter den Hügeln, die das Tal von allen Seiten einschlossen, war etwas geschehen. Khawa brauchte nicht zu sehen, was passiert war, um zu wissen, dass Skiran nicht mehr war. Mit seinem Schrei hatte der Kundschafter das Letzte getan, was ihm möglich gewesen war, um seinen Kameraden zu helfen.
»Abbruch!«, brüllte Khawa. »Flucht nach Süden!« Es war die entgegengesetzte Richtung, von der aus der Schrei ertönt war. Khawa trieb seine Hyäne an, galoppierte einige Schritte und glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. Er riss das Tier im vollen Lauf herum, mit ihm schwenkte seine Truppe zur Seite. Hinter dem Hügelkamm waren Lanzenspitzen aufgetaucht, denen nun eiserne Helme folgten. An den Schäften hingen, schlaff vom Regen, die Banner der almanischen Adelshäuser.
Die Hyänen jaulten, ein Konzert von Jagdlust und Nervosität. Khawa blickte sich in alle Richtungen um, während er ritt, doch es gab keinen Fluchtweg und er hörte damit auf, sein Tier in immer neue Richtungen zu treiben. Die Hyäne tänzelte auf der Stelle, nur mit Mühe hielt er sie unter Kontrolle. Die Rakshaner drängten sich zu einem Kreis zusammen. Auf allen Hügelkämmen waren Eisenhelme aufgetaucht. Innerhalb weniger Augenblicke war Khawas gesamte Einheit von Chevaliers und lanzentragenden Fußsoldaten eingekesselt worden. Wie hatte das geschehen können? Woher hatten die Almanen gewusst, wo sie sich befanden?
Khawa kam nicht mehr dazu, sich weitere Gedanken zu machen. Er musste eine Entscheidung treffen, und zwar sofort. Er zog in einer fließenden Bewegung einen Pfeil aus dem Köcher, riss seinen Bogen in Schulterhöhe und spannte. »Angriff! Gebt alles!« Zeitgleich ließ er die Sehne los.
Es knallte, als der Pfeil in einen gerüsteten Körper einschlug. Ein Fußsoldat ging zu Boden. Sofort eröffneten die Almanen das Gegenfeuer. Als der erste Eisenmann fiel, stürzten fast gleichzeitig mehrere Hyänenreiter von ihren Tieren. Eine Reihe von Bogenschützen musste sich hinter den Chevaliers und den Lanzenträgern verbergen.
Khawa legte den nächsten Pfeil ein und schoss. Die Hyäne des Reiters neben ihm kreischte. Sie war von Pfeilen gespickt und ging durch. Ihr Reiter rutschte bereits leblos von ihrem Rücken. Das große Raubtier stürmte auf die Reihe der Almanen zu und biss um sich. Ein Fußsoldat hing quer in ihrem Maul und sie schüttelte ihn durch, doch gegen eine geschlossene Linie gerüsteter Soldaten kam auch ein ganzes Rudel von Hyänen nicht an. Mehreren Lanzen spießten sie auf, ehe sie ein zweites Mal mit ihrem todbringenden Gebiss zupacken konnte.
Khawa wurde schlagartig die völlige Aussichtslosigkeit der Lage bewusst. Mochte er ein noch so guter Anführer sein, auch er war nicht allmächtig. Dieser Feind war nicht nur bestens auf seine Truppe vorbereitet und die Bewaffnung passend eingestellt, sondern die Almanen waren auch in der Überzahl. Im Gleichschritt marschierten sie näher, Rüstung an Rüstung. Der Ring der Gegner hatte keine Lücken. Mehr als einen heldenhaften letzten Kampf würden die Hyänenreiter ihnen nicht entgegensetzen können. Dies war ihr Ende.
»Blut!«, brüllte Khawa und riss seinen Hornbogen in die Luft. Mit diesem Ruf löste er seinen Kommandoanspruch auf und gab das Signal zum letzten Gefecht. Es war der letzte Befehl des Anführers einer todgeweihten Gruppe, der letzte Befehl des Steppensturms. Sie würden bis auf den letzten Mann sterben, aber das war es wert. Zum Leben eines Plünderers gehörte auch ein früher Tod. Khawa hatte sich freiwillig für dieses Leben entschieden und somit auch für ein zeitiges Sterben. Er hätte auch hinter der Front bleiben und als einfacher Nomade sein Leben führen können. Doch das war nicht, wofür Khawa fo-Azenkwed geboren war!
Er ließ den Bogen zu Boden fallen und riss seinen Knochensäbel aus der Scheide. Er versuchte, zu erkennen, wo der Befehlshaber der Almanen sich befand. Den Kerl würde er auf die andere Seite mitnehmen. So wie Skiran mit seinem letzten Atemzug für seine Kameraden gekämpft hatte, würde auch Khawa es tun und jeder einzelne, der unter seinem Kommando gestanden hatte.
Es zischte erneut, neben Khawa brach eine Hyäne zusammen und begrub ihren Reiter unter sich. Ein weiterer Pfeil flog knapp an Khawas Turban vorbei und bohrte sich in die Stirn des Rakshaners hinter ihm. Viele waren nicht mehr geblieben. Die Almanen zogen ihren Kreis enger und stellten das Schießen nun ein, um nicht ihre eigenen Kameraden auf der gegenüberliegenden Seite zu gefährden. Der Regen, der die Rakshaner zuvor geschützt hatte, würde ihr Leichentuch werden.
Khawa ritt in einem letzten Akt des Aufbegehrens gegen das Unvermeidliche auf die Linie der gepanzerten Soldaten zu. Er hatte wegen der Dunkelheit den Anführer nicht ausmachen können und würde ein willkürliches Opfer wählen. Die letzten Überlebenden seiner Truppe folgten seinem Beispiel und gemeinsam stürmten sie im Pulk auf die Almanen zu. Er trieb sein Tier zum schnellstmöglichen Galopp an, in der Absicht, es kurz vor den Lanzen abspringen und mitten in der Reihe der Soldaten landen zu lassen. Er kam bis kurz vor die Sprungweite, dann brach seine Hyäne unter ihm zusammen. Khawa machte einen Überschlag und rollte durch den Schlamm. Die Pfoten der anderen Tiere trampelten über ihn hinweg, er wälzte sich hin und her, um nicht zertreten zu werden. Der Schlag einer Pfote traf ihn, stark wie der Tritt eines Pferdehufes, und schleuderte ihn ein Stück durch die Luft. Erneut stürzte er auf den nassen Erdboden. Um Luft ringend blieb Khawa liegen, das vermummte Gesicht im Dreck. Seinen Säbel hatte er verloren, ebenso wie seinen Bogen.
Verebbende Schlachtrufe, letztes Geschrei purer Todesverachtung, dann wurde es still. Kein Keckern, kein Jaulen mehr und kein rakshanisches Wort. Nur das schwere Klirren almanischer Rüstungen und Stimmen, die in der fremden Sprache redeten. Der Regen prasselte auf den besiegten Anführer des Plündertrupps nieder.
Und noch immer war er am Leben. Es entsprach nicht dem Wesen eines Rakshaners, eine so vernichtende Niederlage zu überleben und eine Gefangennahme zu riskieren. Etwas Schlimmeres, als den Verlust der Freiheit, gab es nicht. Khawa musste den Almanen zeigen, dass er noch lebte, damit sie ihn ins Chaos schicken konnten, in dem alles seinen Anfang genommen hatte und in dem alles enden würde. Sich selbst zu richten wäre der Akt eines Feiglings. Eine jede noch so verbitterte Feindschaft nahm nach rakshanischer Vorstellung mit dem Töten des Gegners ein Ende. Almanen und Rakshaner verbrachte ihr gesamtes Leben als Feinde, doch sie starben als enge Vertraute, denn etwas Intimeres als den Tod konnte man nicht mit jemandem teilen.
Mühsam stützte Khawa sich auf die Unterarme und rappelte er sich auf alle viere. Schmerzen im Bauch quälten ihn. Sein Herz schlug heftig und seine Lungen pumpten die kalte, regenschwere Luft. Sein Körper tat alles, um ihn am Leben zu erhalten, er war nicht mit dem einverstanden, was nun geschehen sollte. Khawa hob den Kopf mit dem nassen Turban, um zu schauen, wer es sein würde, der ihm den Tod eines Kriegers gewähren würde. Unerwartet dicht vor ihm stand ein Paar schlammverschmierter eiserner Panzerstiefel. Khawa sah die Beine entlang nach oben und erblickte einen Chevalier in Kettenrüstung und einem Wappenrock darüber. Das musste der Anführer dieser Streitmacht sein. Ein würdiger Todbringer für den Steppensturm. In seiner Hand hielt der Almane das gezogene Schwert. Doch er wartete noch. Offenbar war er doch nicht derjenige, der hier das letzte Wort innehatte.
Neben ihn trat ein junger Mann in einer äußerst aufwändigen Rüstung. Das Visier seines Helmes hatte er nach oben geklappt, um besser sehen zu können, so dass auch Khawa sein blasses Gesicht erkennen konnte. Während der erwachsene Ritter sicher zu sein schien, was nun zu tun sei, war dem jungen Mann Nachdenklichkeit ins Gesicht geschrieben. Er war noch zu jung für das Führen einer Streitmacht. Wahrscheinlich war der andere in Wahrheit der Kopf hinter dem Ganzen gewesen.
Das vermummte Gesicht Khawas war verzerrt vor Angst. Trotz aller Mühe, sich zu beherrschen, hatte er im Angesicht seiner Hinrichtung am ganzen Leib zu zittern begonnen. Er war nie ein Feigling gewesen, doch nun überkam ihn Panik. Er war nicht bereit für den Tod, er wollte nicht sterben! Es gab nur wenige Worte auf Almanisch, die er kannte. Dazu gehörten jene, die er nun sprach.
»Bitte! Mein Leben!«
Khawa hätte jeden ausgelacht, der ihm erzählte, vor einem Feind um Gnade gewinselt zu haben, und nun tat er es selbst. Er bettelte in einer fremden Sprache, im Dreck eines fremden Landes auf Knien um sein Leben.
Ob es dem jungen Alter des einen Mannes und seiner noch mangelnden Abgestumpftheit zu verdanken war oder ob das Flehen des Todgeweihten tatsächlich sein Herz berührte – Khawas Bitte um Gnade wurde stattgegeben. Er durfte sich erheben.
Man trieb ihn zu Fuß zwischen den schweren Schlachtrössern vor sich her. Sherkal würde ihn nicht wiedersehen. Seine Kameraden daheim würden vergebens auf die Heimkehr von Khawa und seiner Truppe warten. Ein letzter Blick auf seine gefallenen Kameraden war ihm nicht vergönnt.
Khawa verlor an diesem Morgen seine Krieger, seinen Rang, seine Familie, seine Freiheit und die wilde Steppenheimat, in der er gelebt hatte. Was blieb, war ein Sklave in einer fremden Welt, in der man Behausungen aus Stein baute und sich mit hohen Mauern umgab. Ein Land, in dem ein Mensch das Eigentum eines anderen sein konnte und in dem man die Gesetze von einem Papier ablas anstatt aus dem Flug der Sandwehen und dem Knochenfraß der Geier. Almanien empfing den Fremdling mit steinernem Stolz und eiserner Distanziertheit. Es starrte aus den Schießscharten der Burgen auf ihn herab, aus den wachsamen Augen der Gargoyles auf den Zinnen und aus den schwarzen Augenöffnungen der Ritterhelme. Nach langem Marsch erreichten sie Beaufort, den Sitz des Ducs von Großherzogtum Souvagne. Das Tor der Burg öffnete sich, ließ die Delegation eintreten. Hinter Khawa schloss sie sich mit einem endgültigen Geräusch.
Der Steppensturm war Geschichte. Wer verblieben war, wusste Khawa nicht.
Weiter geht es bei Amazon! Link

Neue Jagdgründe

Genre: Fantasy, Homoerotik
Status: veröffentlicht, Neue Jagdgründe bei Amazon
Inhalt:
Meermenschen mal anders: Romanze von Haimann & Feuerfischmann.
In einer Bucht mit lichtdurchflutetem Wasser leben die Haimenschen, welche sich selbst die Sandjäger nennen. So idyllisch ihr Heimatgewässer auch erscheint, ihr Leben ist geprägt von einer brutalen Beißordnung und rücksichtslosem Egoismus. Der junge und für einen Sandjäger noch schmächtig gebaute Shocai schafft es nicht länger, sich gegen seine älteren Rivalen zu behaupten. Blutig gebissen flieht er in die offene See.
Nachdem er endlich das andere Ufer erreicht hat, lernt er Lahiko vom Schwarm der Giftstachler kennen, einen Träumer und Tänzer. Betrachtet Shocai den kleinen gestreiften Kerl anfangs nur als potenzielle Mahlzeit, lehrt Lahiko ihn bald, dass es nicht immer notwendig ist, zu kämpfen, wenn man sich stattdessen gegenseitig helfen kann. Für Shocai, der als Einzelkämpfer aufwuchs, ist das eine völlig neue Erfahrung. Doch er ist neugierig. Schlussendlich lässt er sich sogar von Lahiko zum Tanz einladen, nicht wissend, dass dies der Auftakt eines ganz besonderen Rituals ist …
3D
Terra Anura

Genre: Science Fiction, Gay Romance
Status: 90 % des Erstentwurfes
Geplante Veröffentlichung: Winter 2018
Eine düstere, nachdenkliche Geschichte und etwas schräg. Was darf Forschung und was darf sie nicht? Wo beginnt der Mensch und wo hört er auf?
Inhalt:
In nicht allzu ferner Zukunft ist es möglich, Hybriden aus Menschen und Fröschen zu erschaffen. Sie dienen der sexuellen Belustigung reicher Gäste in einem berüchtigten Varietè namens Terra Anura. Jeder einzelne Anura-Hybrid geht mit diesem Schicksal anders um. Auf dem Pfad zwischen Mensch und Tier, zwischen Opfer und Täter sind sie auf der Suche nach der eigenen Identität, nach einem Leben und einer Liebe, die nur ihnen gehört. Drei gänzlich unterschiedliche Hybriden beschließen, dem Schicksal die Stirn zu bieten und nicht länger nur Objekte der Forschung und der Lust zu sein: der intelligente, geistig unterforderte Yabo, der sich selbst vollkommen verloren hat, der übergewichtige Ringo, der vom sanften Gemüt zum Egozentriker geworden ist und der Neuling Azul, der ein dunkles Geheimnis zu verbergen scheint. Aber werden sie die Terra Anura wirklich hinter sich lassen können? Und wenn ja, um welchen Preis?